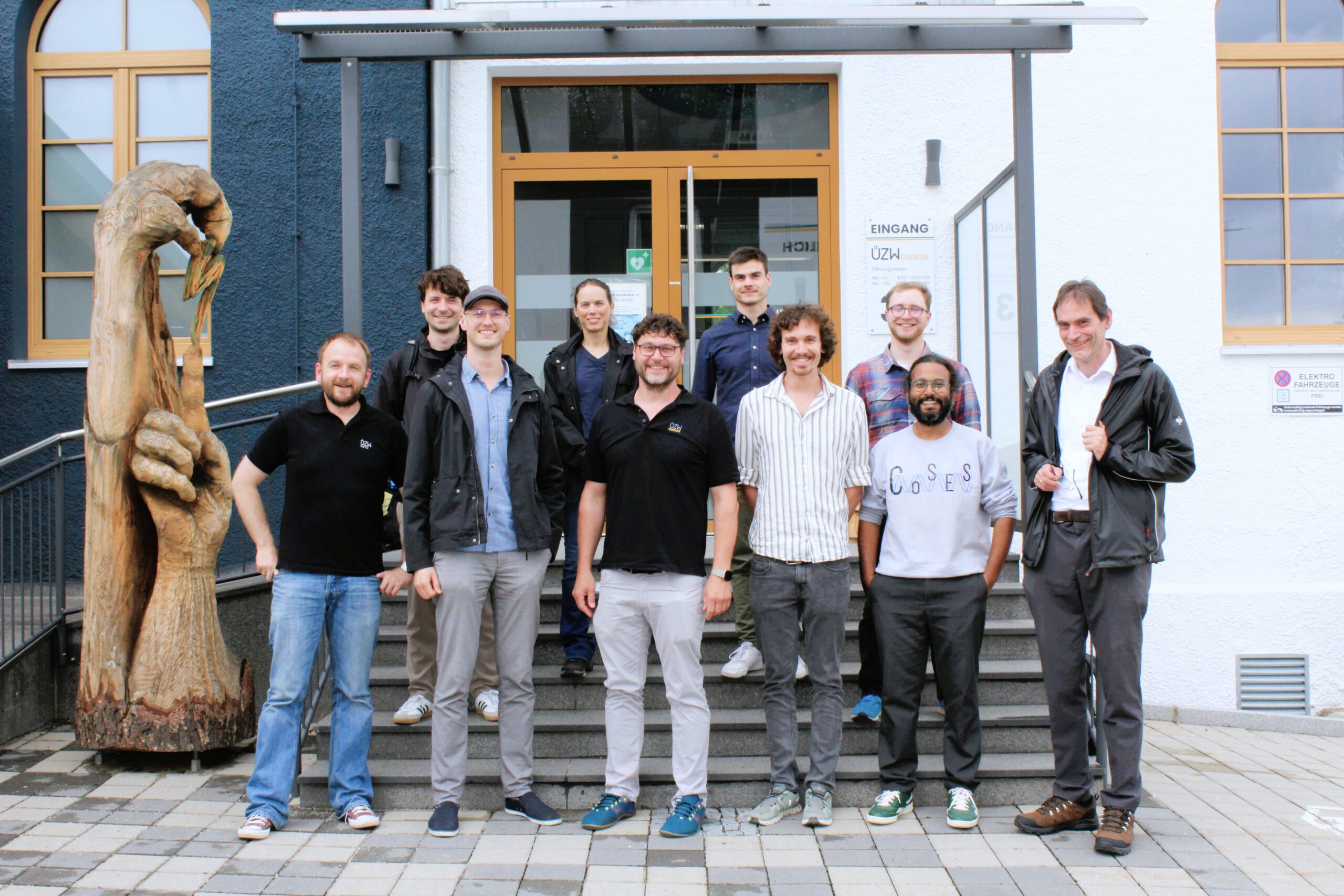Neues Forschungsprojekt PhyLFlex entwickelt intelligente Energiemanagementsysteme und ermöglicht stärkere Integration erneuerbarer Energien
Die Anforderungen an Stromnetze steigen zunehmend: Der Ausbau der erneuerbaren Energien führt zu Schwankungen im Stromangebot. Die verstärkte Nutzung von Elektrofahrzeugen und Wärmepumpen können zusätzliche Spitzen im Stromverbrauch auslösen, wenn zum Beispiel viele E-Autos gleichzeitig am Abend aufgeladen werden. Um die Energieversorgung auch unter diesen Bedingungen effizient und zuverlässig zu gestalten, sind intelligente und flexible Lösungen zur Steuerung von Stromangebot und -nachfrage unerlässlich. Das neue Forschungsprojekt PhyLFlex stellt sich dieser Herausforderung und entwickelt innovative Systeme zur Energieverbrauchsoptimierung. Dabei arbeitet die Hochschule Landshut zusammen mit der Technischen Universität München, der Siemens AG, der ÜZW Energie AG und weiteren assoziierten Partnern.
Den Energieverbrauch von Gebäuden optimieren
Ziel des Projekts ist es, fortschrittliche Gebäude-Energie-ManagementSysteme zu entwickeln und zu implementieren. Wie ein „Gehirn“ überwachen, steuern und optimieren sie den Energieverbrauch eines Gebäudes. Durch den verstärkten Einsatz dieser digitalen Systeme sollen die Verteilnetze in Deutschland effizienter genutzt und in ihrer Resilienz unterstützt werden. Die Netzstabilität soll sichergestellt werden, ohne die Stromnetze in unnötigem Ausmaß ausbauen zu müssen.
Ermöglicht stärkere Einbindung erneuerbarer Energien
„Die Herausforderung in der Energiewende liegt nicht nur im Ausbau erneuerbarer Energien, sondern auch in der intelligenten Steuerung der Netzlast. Mit PhyLFlex entwickeln wir Lösungen, die dieser Herausforderung gerecht werden können und somit die Integration erneuerbarer Energien fördern“, erklärt Prof. Dr. Maren Martens. „Ich bin sehr stolz, im Rahmen des Projekts nicht nur zur Reduzierung der Netzausbaukosten, sondern auch zur Beschleunigung der Energiewende und zur Erhöhung der Versorgungssicherheit beitragen zu können.“ Die Professorin für Wirtschaftsmathematik leitet das Projekt an der Hochschule Landshut. Gemeinsam mit dem wissenschaftlichen Mitarbeiter Ulrich Ludolfinger hat sie das Projekt im Rahmen ihrer Forschungstätigkeiten am hochschulinternen Institute for Data and Process Science eingeworben.
Kombination von physikalischen Prinzipien mit Möglichkeiten der KI
In PhyLFlex werden Gebäude-Energie-Management-Systeme entwickelt, die in der Lage sind, sich dynamisch an verschiedene Gebäudetypen und Netzbedingungen anzupassen. Dies ist entscheidend, um den Energieverbrauch in einer zunehmend dezentralen und komplexen Energieinfrastruktur zu optimieren. Besonders innovativ ist in PhyLFlex, dass dabei auf die Kombination von physikalisch basierten Modellen mit modernen Methoden der künstlichen Intelligenz gesetzt wird.
Diese Kombination wird durch die Zusammenarbeit von der Hochschule Landshut und der TU München ermöglicht, durch welche ein besonders intelligentes System geschaffen wird. Es integriert physikalische Gesetze zur Energieerhaltung und zu Energieflüssen innerhalb eines Gebäudes mit Techniken des maschinellen Lernens, was es ermöglicht, das Energieverhalten in Echtzeit zu steuern und zu optimieren. Der Beitrag der Hochschule Landshut liegt dabei im Bereich der KI.
Das intelligente System wird in der Praxis erprobt
Ein zentrales Ziel des Projekts ist es, die entwickelten Lösungen in realen Umgebungen zu testen und kontinuierlich zu verbessern. Im Netz der ÜZW wird die Praxistauglichkeit der Ansätze unter realen Bedingungen erprobt. Gleichzeitig unterstützt Siemens das Projekt mit innovativen Lastvorhersagen auf Netz- und Gebäudeebene, die eine optimierte Planung und Steuerung ermöglichen. So wird sichergestellt, dass die Systeme nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis effektiv funktionieren.
Darüber hinaus unterstützen die enercast GmbH, die Theben Smart Energy GmbH und die Hochschule Ansbach das Vorhaben als assoziierte Partner. Das Projekt wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE) im Rahmen des 8. Energieforschungsprogramms der Bundesregierung bis März 2027 für drei Jahre finanziell gefördert. Die Fördersumme beträgt gut 1,5 Millionen Euro.